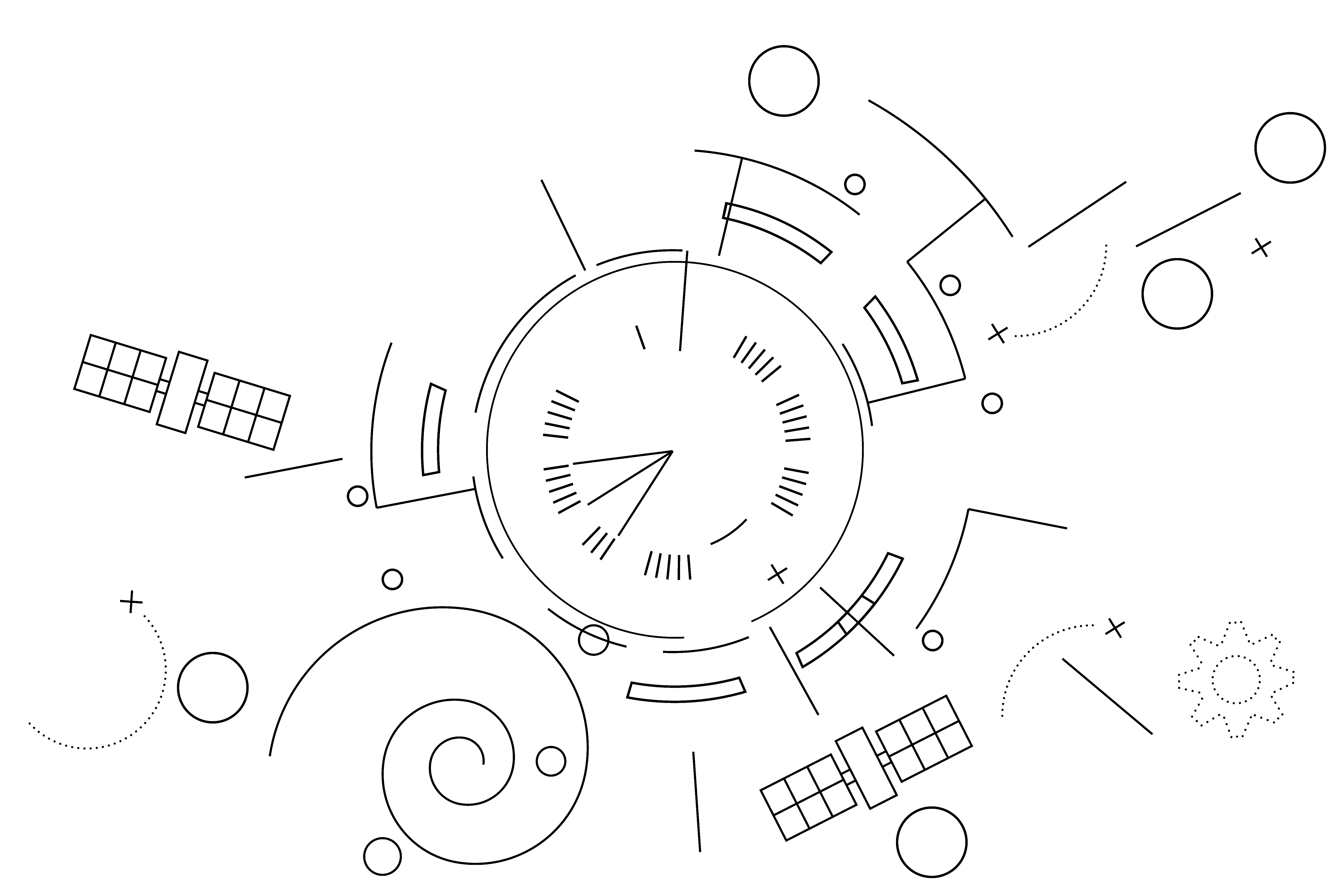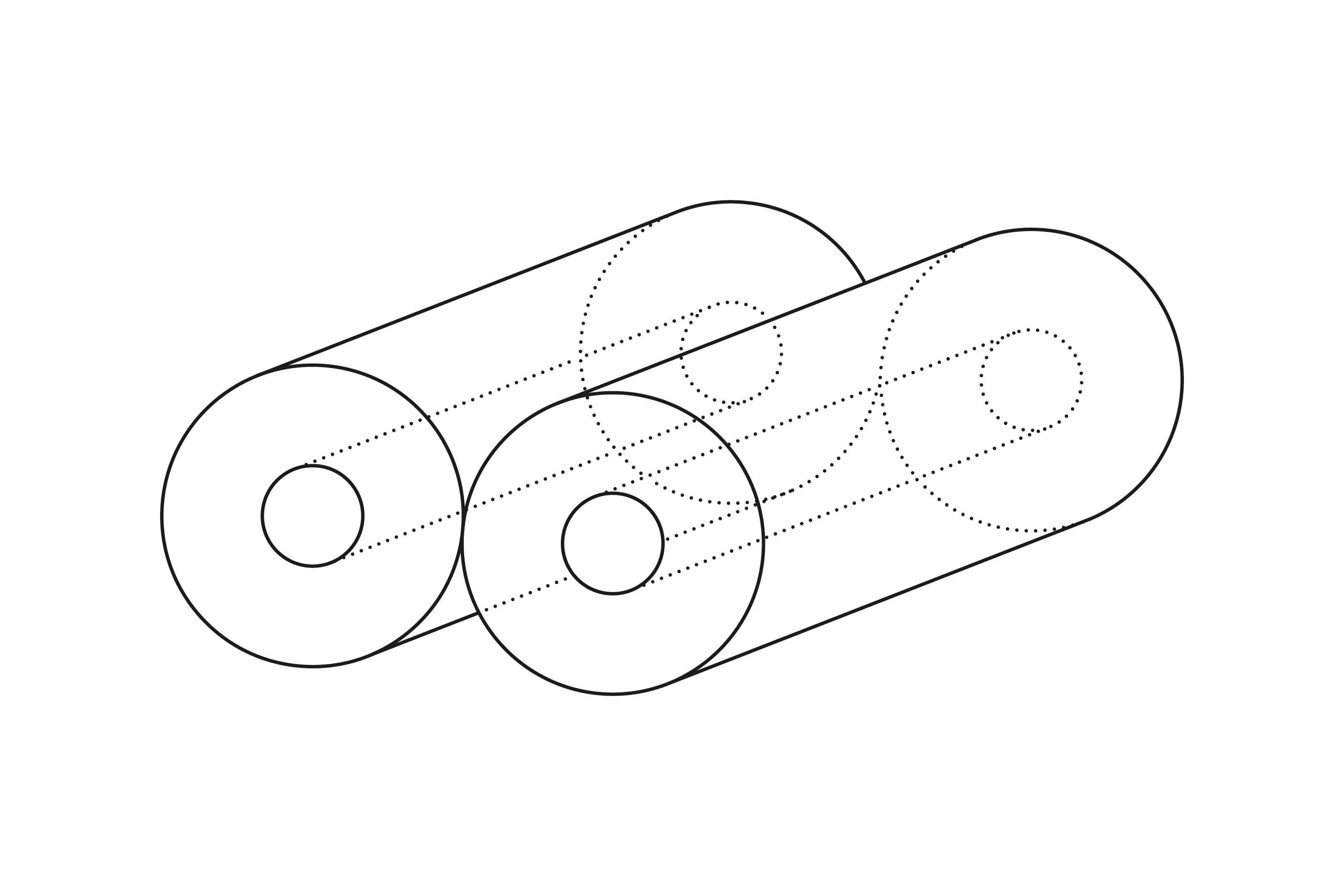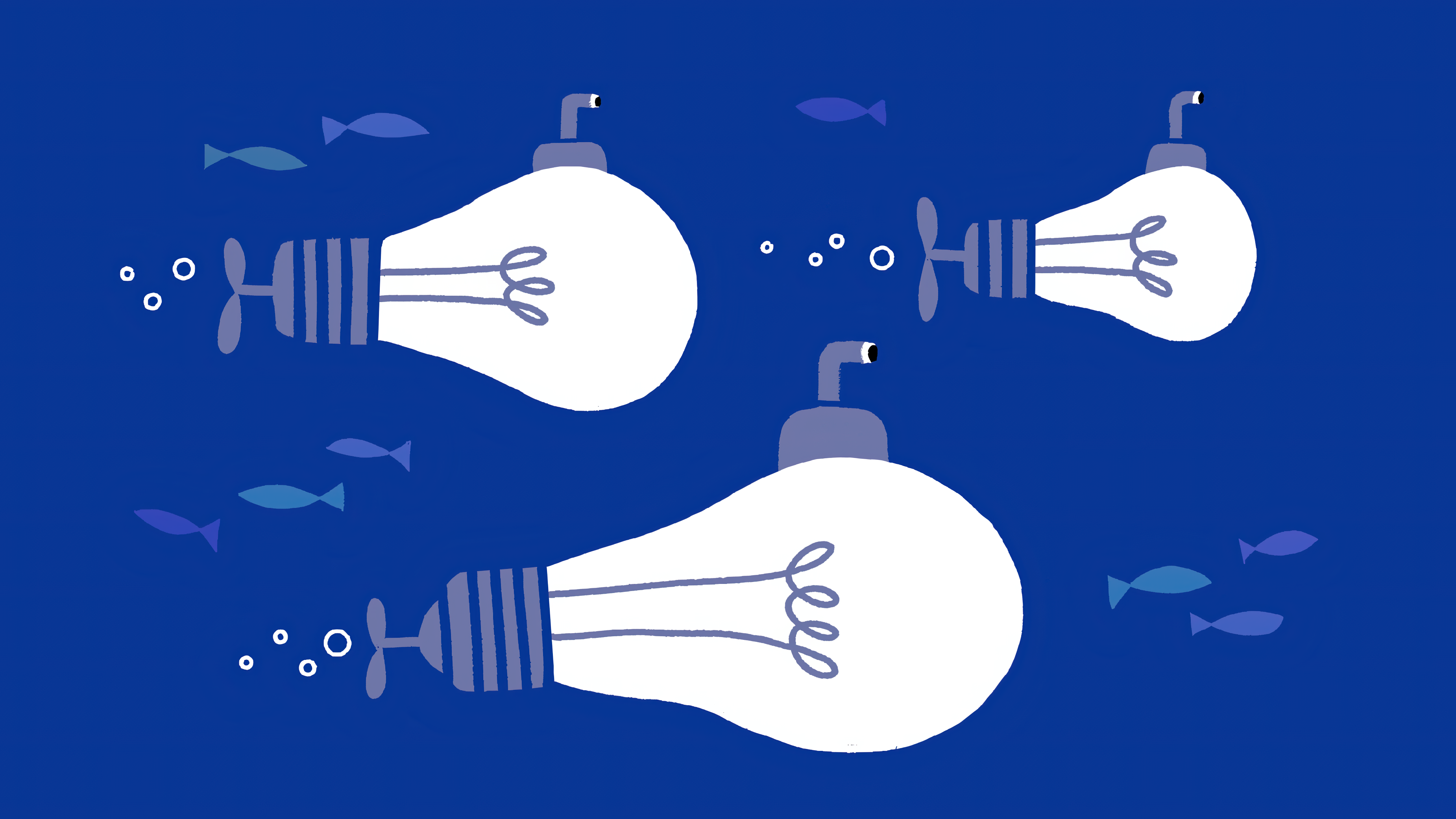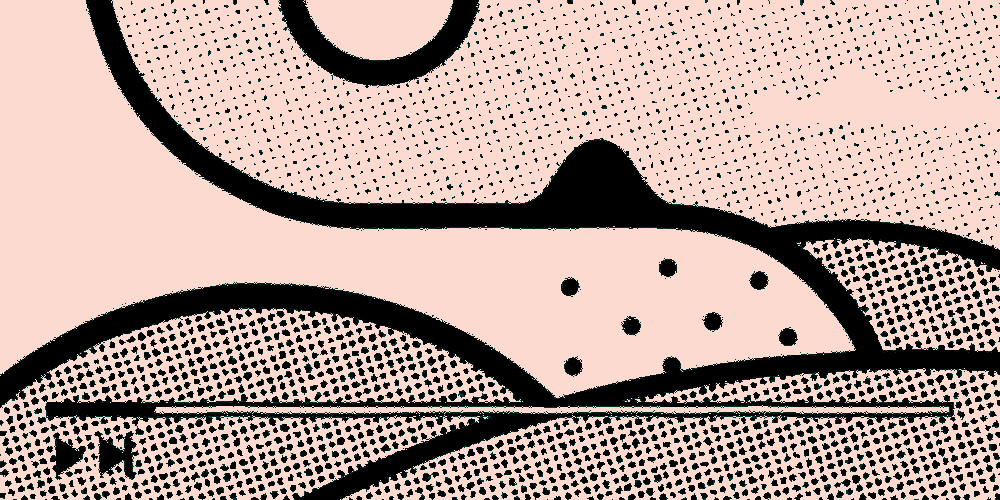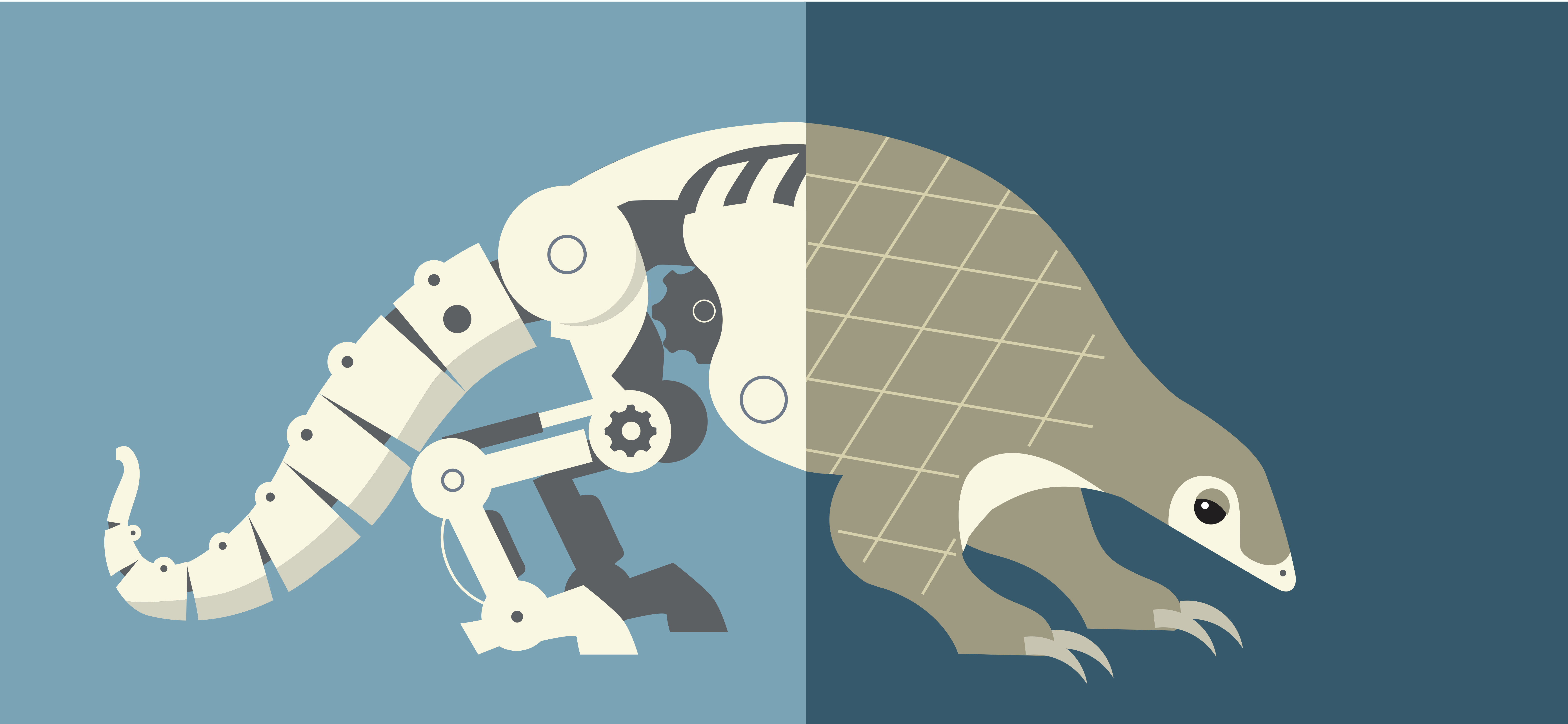Für die Schweiz und ganz Europa entsteht eine historische Chance, um Talente zu gewinnen, die nicht den Weg in eine idealisierte Vergangenheit gehen, sondern neue Zukünfte umarmen wollen. Gemeinsam könnte man Rückstände in skalierbaren geopolitischen Schlüsseltechnologien wettmachen.
Wie aber gestalten wir die Schleusen, um die visionären Denker:innen in die Arme Helvetias zu lenken?
Kapital fliesst nur, wenn es sein Ziel kennt. Doch die Alpenrepublik Schweiz steht ohne Vision dar. Zumindest mir ist unklar, in welche Zukunft sich das Land bewegt. Traut sie sich, Idealen abzustreifen, die aus der Zeit gefallen sind? Die Schwäche, keine Schwäche zu zeigen. Die Bauernromantik. Die männlichen Führungskulturen. Die Konsenssucht.
Genauso unklar ist, wie die Schweiz ihre Old Economy ins neue Zeitalter führen will: Die Banken, tierprotein-reiche Käse- und Schokoladen-Spezialitäten, die nostalgischen Prunkuhren? Es ist kaum ein Zufall, dass ihre Zugpferde (Nestlé, Roche und Novartis) seit Jahren lustlos an der Börse hin- und herpendeln.
Es ginge anders: Helvetia könnte ein DeFi-Hotspot sein, ein Medtech-Labor des demografischen Wandels, ein Cyberbunker, eine Weltraummaschinen-Fabrik.
Die Schweizer Hochschulen sind Weltklasse. Um sie für den US Braindrain attraktiver zu machen, könnte man sie an die helvetische Visionsarbeit koppeln. Das heisst nicht Forschung zu diktieren, aber etwas mehr Planwirtschaft würde zurzeit nicht schaden.
Damit die Schweizer Hochschulen als Magnete der Humankapitalflüsse taugen, braucht es zudem einfache Bewerbungs- und Bewilligungsverfahren.
Auf die Spitze getrieben: eine E-Mail mit einschlägiger Publikations- und Projektliste genügt zum Eintritt. Pro Jahr könnte die Schweiz hundert Forschenden ein Grundeinkommen zahlen.
Gleichzeitig dürften die Universitäten ihrer Volksnähe steigern. Das setzt neben Anlässen und neuen Publikationsformaten die Präsenz in Innenstädten voraus, mit Ausstellungen und Pop-Up-Instituten.
Schweizer Städte brillieren nicht durch Offenheit – weder mit Architektur, die neugierig macht, noch mit lebendigen öffentlichen Plätzen, noch mit fröhlicher Gesprächsbereitschaft, noch mit gutem Englisch.
Eine verführerische Leitlinie für die Schweizer Stadt der Zukunft ist die Healing Architecture. Ihre Häuser und Strassen würden so designt, dass sie sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken – durch mehr Farben, mehr Kunst im öffentlichen Raum, mehr natürliche Materialien, mehr Durchlässigkeit.
Wollen Schweizer Städte wachsen und gleichzeitig das Prinzip der 10-Minuten-Nachbarschaft einhalten können, stehen sie vor umfassender Verdichtung. Aufstockungen, erleichterte Umzonungen und schnell bewilligte Umnutzungen von alten Infrastrukturen und Gebäuden öffnen neue Räume.
Die Schweiz ist ein kleines Land mit einem durchaus beeindruckenden Leistungsausweis. Ihre Lebens-qualität, ihre Forschungsinstitute, ihre Institutionen, ihre politische Stabilität, ihr Franken ihr manischer Swiss Finish sind weltweit anerkannt.
Aber die Schweiz ist zu klein, um die Welt zu retten. Und sie ist zu klein, um alles Humankapital aufzufangen, das in den nächsten Jahren aus den USA abfliessen wird. Deshalb braucht es europäische Allianzen – um die Forschenden, Startups und Datensätze einzufangen. Das ist alles nicht zum ersten Mal gedacht, und doch bleibt es unspürbar.
Wo bleiben Bündnisse und Infrastrukturen, mit alpinen Norwegern und Grönländerinnen, potenten Holländern, aufstrebenden Polinnen? Warum reichen die Visionen nicht bis China, Zentralasien und Afrika?
Im Kalten Krieg riefen Bundesräte und Obersten die Schweiz zur “geistigen Landesverteidigung” auf. Die Bevölkerung sollte sich gegen Totalitäres abschirmen, zuerst gegen die Nazis, dann gegen die Kommunisten.
Wir treten jetzt wieder in eine Phase, wo die Verteidigung des Geistes essenziell wird. Aber anders als letztes Mal sollte die Verteidigung weder die isolationistische, noch die nationalistische, noch die schwarz-weisse Schweiz fördern. Die nächsten Jahre brauchen Vernetzung, Weitsicht – und Sanftmut.
Gefragt ist eine neue Offenheit, zum Beispiel gegenüber asiatischen Unternehmen oder den Potenzialen futuristischer Technologien. Nur wenn die Schweiz das Neue offen zu empfangen lernt, wird sie sich mit Hilfe von Zugewanderten neu erfinden und die hochmargigen Zukunftsmärkte erobern.
Ich könnte wiederholen, dass nun Konsequenz und Tempo gefragt sind. Aber Wiederholungen langweilen mich – und es gibt noch ein anderes, kaum benanntes Defizit der Schweiz.
Dem Land fehlt es zurzeit an frischen Köpfen, die in der Öffentlichkeit, in den (neuen) Medien und an Veranstaltungen aller Art die Ideen für eine neue Schweiz bündeln und gewinnend vertreten. Diesen Köpfen darf das 20. Jahrhundert nicht ankleben. Sie repräsentieren den Aufbruch des Einundzwanzigsten.
Diese Gesichter wären von einem starken Sachbuchverlag getragen, aber auch von Veranstaltenden, die gezielt Schweizer Intellektuelle einladen.