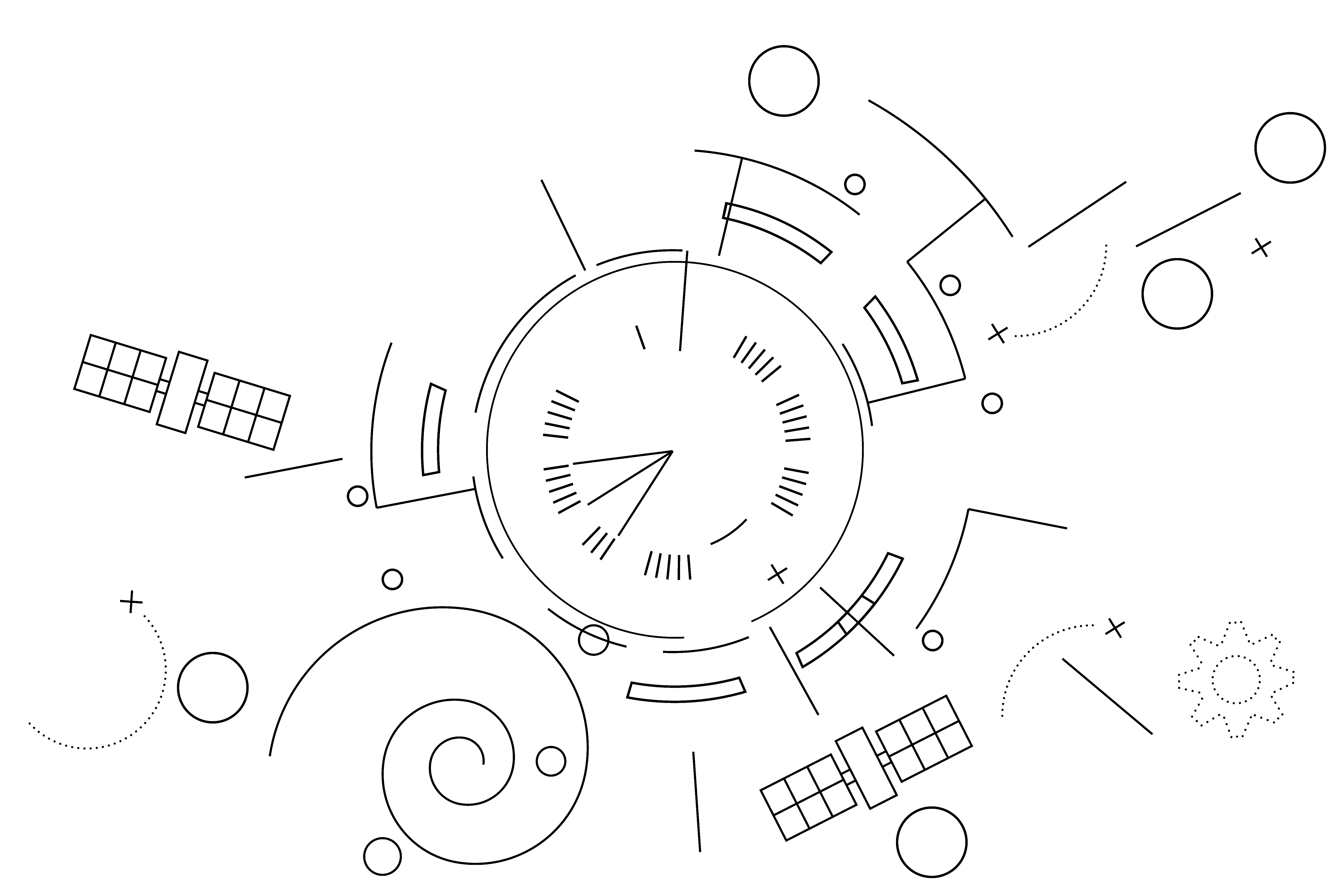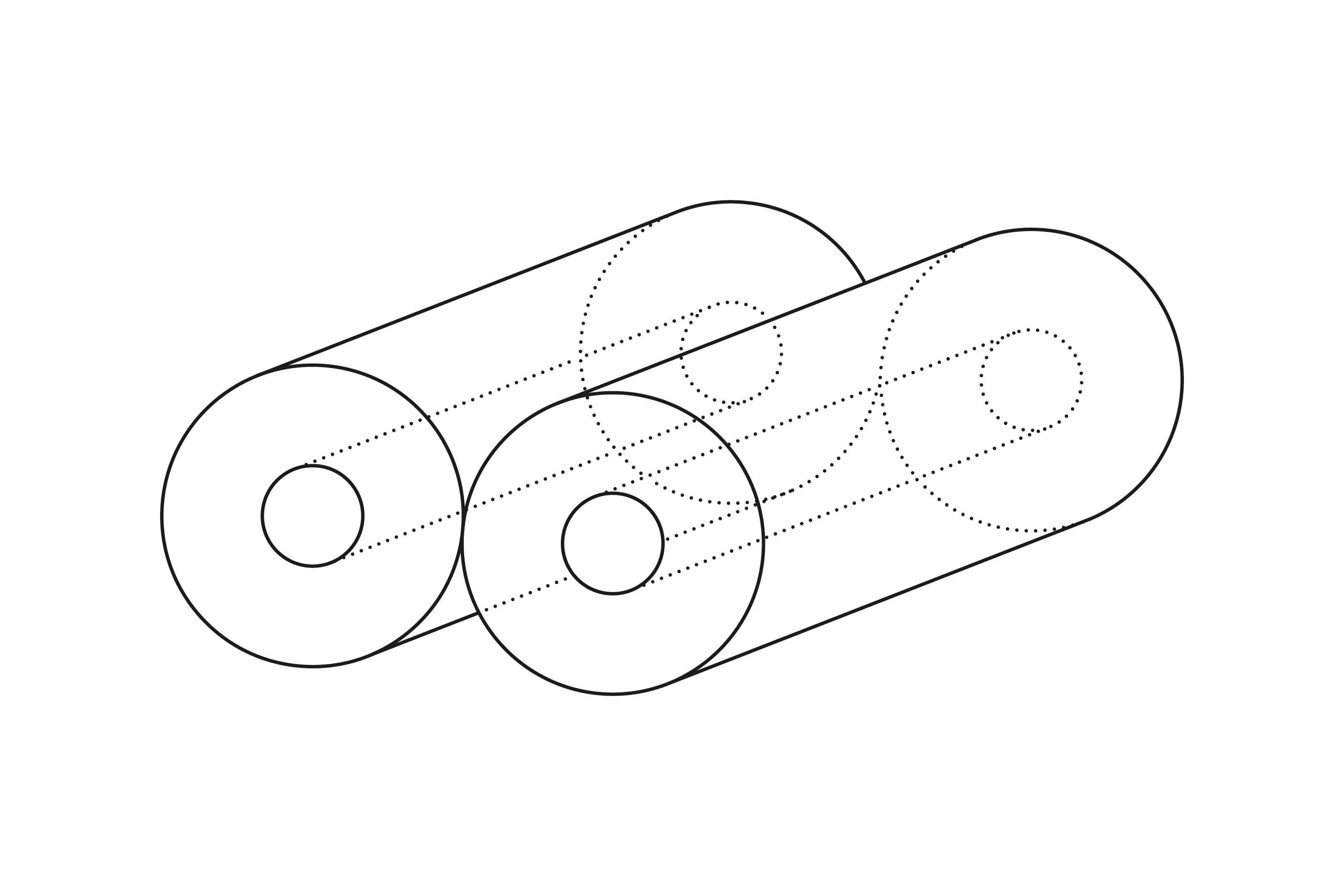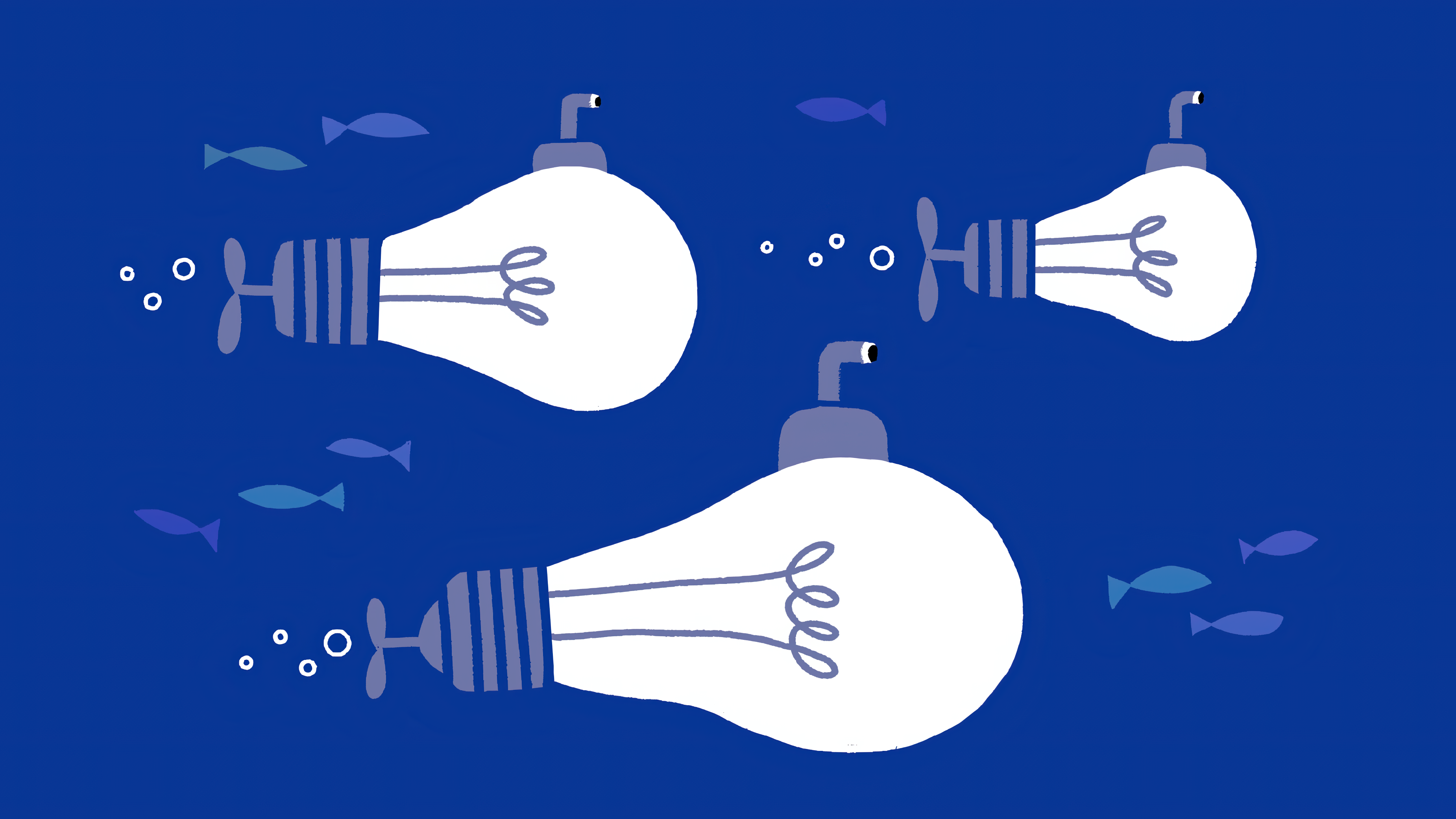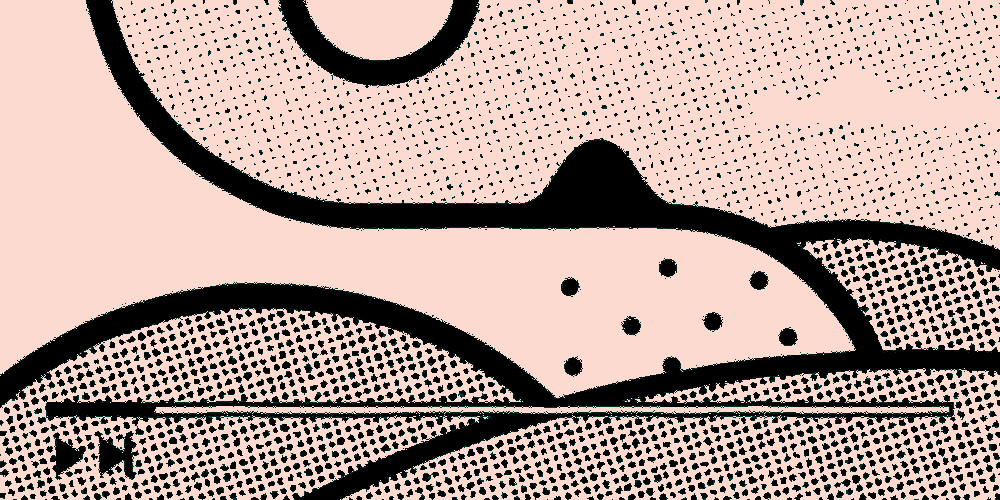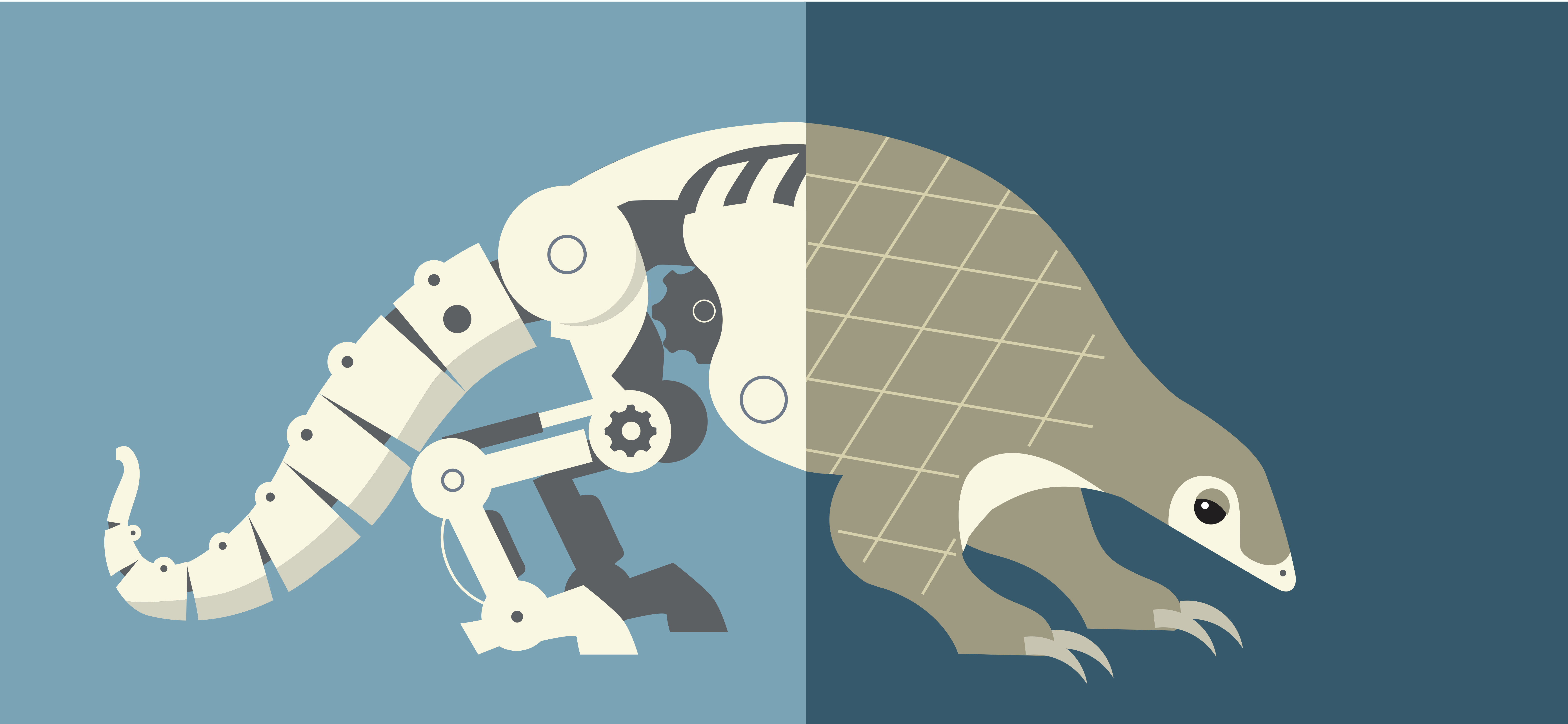Das geforderte Fitnessprogramm konkretisiere ich entlang von 8 Posten. Wichtig: das Training wird ein Jahrzehnt dauern und der Zollhammer ist nur Symptom für tektonische geoökonomische Verschiebungen. Kettenreaktionen ziehen alle in den Strudel, in einer Zeit in der die Schweizer Wirtschaft als träge beschrieben wird. Ziel des Parcours ist eine gestärkte Zukunftsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und mehr Lust auf Zukunft.
POSTEN 1: DIGITALE VERLAGERUNGEN
In der Schweiz haben 99% der Menschen ein Smartphone. Auch die Seniorinnen und Senioren: 95% der 65-75-Jährigen nutzen sie, bei den 85+ sind es knapp über die Hälfte.
Aber noch immer verzeichnet die Schweiz digitalen Rückstand. Für Rappenbeträge werden Papierrechnungen verschickt, Museen käme es nicht (wie in den Niederlanden) in den Sinn, Tickets nur noch digital zu verkaufen, im Zug werden Fahrscheine wie vor 100 Jahren kontrolliert. Digitale Krankenakte für Mensch und Tier: Fehlanzeige. Effizient, schnell und datenaffin ist das nicht.
Digitale Verlagerung heisst nun schnell zu digitalisieren aber auch US-Abhängigkeiten zu reduzieren. Es braucht europäische Lösungen: für die Clouds, die sozialen Medien und die KIs.
POSTEN 2: REVERSE PAPERCLIP
Im Rahmen der Operation Paperclip lotste die amerikanische Regierung nach dem 2. Weltkrieg 1600 deutsche Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Technologie-Experten mehr oder weniger freiwillig in die USA – und startete mit ihnen den grossen Takeoff der Great Acceleration.
In den USA wird es durch die Fortsetzung der Trump-Politik zum grossen Brain Drain kommen. Die Schweiz sollte das Zeitfenster nutzen, um ihre Universitäten und Konzerne als Orte des freien Denkens, des Strebens nach nachhaltigem Fortschritts und Hüterinnen der Vielfalt zu stärken.
Ökonomisch interessant sind für Helvetia 2035 besonders Forschende und Entwickelnde, die sich mit Zukunftstechnologien befassen. Wie können wir uns als Chancenland verkaufen?
POSTEN 3: URBANISIERUNGSTURBO
Das 21. Jahrhundert wird eines der Städte sein. Urbane Zentren funktionieren als wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Transformationsmotoren.
Um diese Funktion wahrnehmen zu können, ist ein urbanes Lebensgefühl wichtig. Es sorgt dafür, dass Talente aus dem In- und Ausland, Start-Ups und den finanzkräftigen Tourismus die Schweiz attraktiv finden. Es entsteht durch digitale Affinität und eine mutige Architektur, die Fantasie, Nachhaltigkeit und Aufbruch zeigt. Ebenso wichtig ist ein zeitgeistiges kulturelles und gastronomisches Angebot.
Die Stadt der Zukunft hat sechs Schlüsselorte, die über ihre Attraktivität entscheiden: Ausstellungen, Parks, Dächer, Wände im öffentlichen Raum, Universitäten und crossmediale Schnittpunkte, etwa wenn TV-Serien in den analogen Raum “wandern”.
POSTEN 4: F&E FÜR ZUKUNFTSMÄRKTE
Damit die Schweizer Wirtschaft künftig gut läuft, braucht es Investitionen in margenstarke Zukunftsmärkte. Diese sind volkswirtschaflich wichtig, aber auch, um Hochqualifizierte an die Hochschulen und in die Unternehmen zu lenken.
Zukunftsmärkte mit hohen Margen zeichnen sich durch einen hohen Anteil an High-Tech bzw. exklusivem Wissen aus. Ebenso wichtig sind eine hohe Zahlungsbereitschaft der Zukunftsmenschen sowie die Möglichkeit der globalen Skalierung.
Mögliche helvetische Zukunftscluster sind die Zukunftsmedizin (Prävention, mRNA, Langlebigkeit, Bioinformatik, Gentechnologie), digitale Fortsetzungen (Quantencomputer, Verschlüsselung, KI-Modelle), die Weltraumwirtschaft sowie Klima- und Recyclingtechnologien.
POSTEN 5: GEOÖKONOMISCHE NETZWERKE
Der Weg in die Zukunft ist offensichtlich geoökonomisch geworden. Wegfallende Märkte müssen kompensiert werden – natürlich in der EU, in Japan, in Zentralasien vielleicht? Zudem muss die Schweiz prüfen, welche Infrastrukturen sie mit wem aufbauen, bewirtschaften, sichern und erneuern will.
Entscheidend sind neben geografischer Nähe und gemeinsamen Visionen für die Zukunft auch der Zugang zu strategische wichtigen Ressourcen und Fähigkeiten. Was fehlt der Schweiz? Was macht sie für andere zu einer spannenden Partnerin?
Naheliegend Partnerregionen sind Berlin, München, Amsterdam und Rotterdam. Auch die skandinavischen Riesen Oslo, Stockholm und Kopenhagen sind als urbane und sozio-innovative Klimagewinner attraktive Partnerinnen.
POSTEN 6: FINANZIELLE ROSSKUR
Die Zoll- und Währungspolitik von Trump macht Produkte von Schweizer Firmen teurer. Dieser Entwicklung kann man Gegensteuer geben, indem man die Kosten senkt. Die von Trump angesetzten Zölle von 39 Prozent entsprechen dem Umfang des Sparpakets.
Wo liegen die offensichtlichen Potenziale, um die Kosten zu senken? Erstens bei teuren analogen und schlechten digitalen Prozessen – und damit in der Integration von KI. Genauso müssen aber im Sinne einer Bereinigung auch die hohe Löhne, Boni und Ausschüttungen an die Aktionärinnen und Aktionäre als Sparpotenziale betrachtet werden.
Sparen können Unternehmen wie Behörden schliesslich durch Exnovation. Dabei wird losgelassen, was zu kompliziert, zu wenig rentabel, zu altmodisch ist. Exnovation ist Fokussierung.
POSTEN 7: POP-UP DEPARTEMENT
Das schweizerische Politiksystem mag stabil und demokratisch sein – aber es hat Mängel, die für die Zukunft zum Problem werden. Ländliche Kantone sind übervertreten, die Departemente riesig, der Verzicht auf ein starken Präsidiums für die Pflege der Auslandsbeziehungen eine grosse Hypothek.
Diese Mängel zu beheben, wird Jahrzehnte dauern. Sollte die Schweiz für ihre Neuausrichtung deshalb auf ein Popup-Departement setzen, das die Transformationen bündelt und datenbasiert (!) steuert? Um es aus den Fesseln der Parteipolitik zu lösen, sollte es wohlmöglich einerQuereinsteigerin mit Wirtschaftserfahrung führen.
In den Unternehmen wird es Zeit, der Generation Y in GLs und VRs Verantwortung zu übertragen. Eine neue Zeit braucht eine neue Führungskultur.
POSTEN 8: FINANZIERUNGSINNOVATIONEN
Ja, ein Mega-Fitnessstudio kostet viel Geld. Zumal die sozialen Folgen von digitaler Verlagerung Kurzarbeit und Entlassungen nicht thematisiert wurden. Aber Hey, haben wir jetzt nicht die perfekte Gelegenheit, um neu durchzustarten?
Wie aber kommen wir zu Geld? Sicher nicht durch das Runterfahren von Nachhaltigkeitszielen und ganz sicher durch den Verzicht auf Kampfflugzeuge.
Nicht innovativ aber wirksam sind Bonds. Es gilt sie zeitgemäss zu vermarkten: In einer Art Crowdfunding stemmen wir generationenübergeifend Investitionen, um in 20 Jahren zu brillieren. Auch neue Steuern bringen Geld ein: auf Finanztransaktionen, superhohen Vermögen, den Supersünden des Anthropozäns (Zucker, Fleisch, CO2, Plastik) den Umsätzen der US-Techkonzerne.