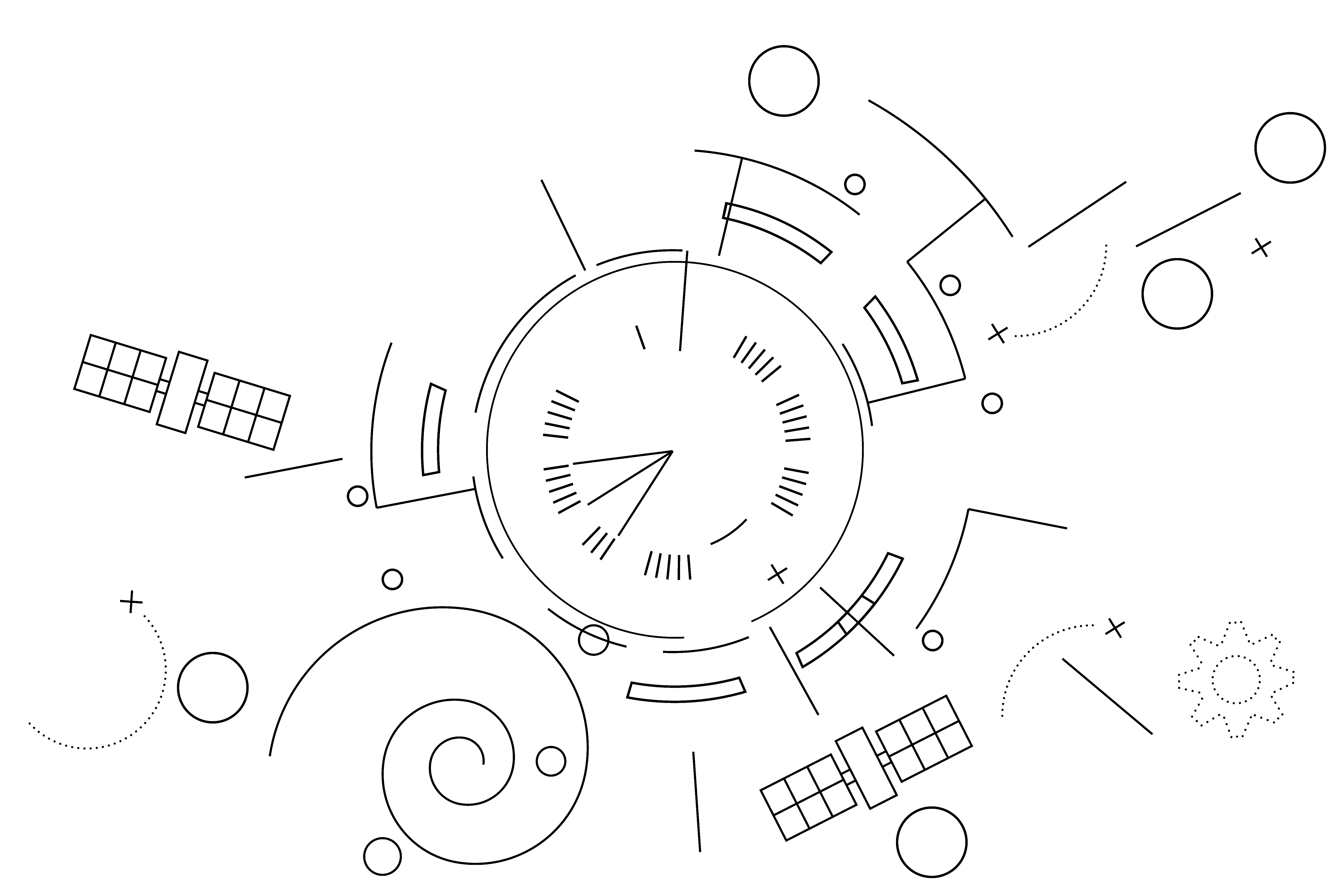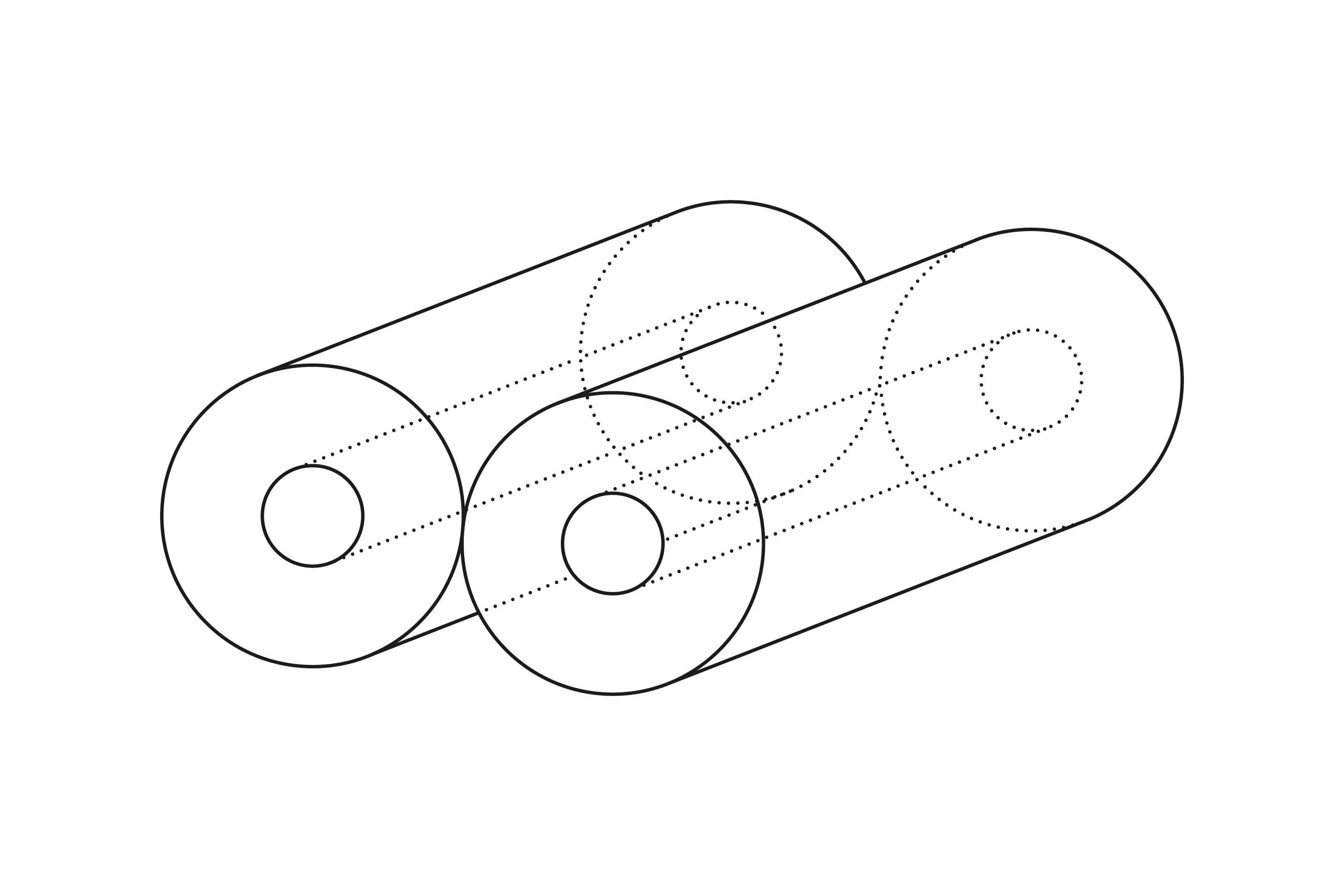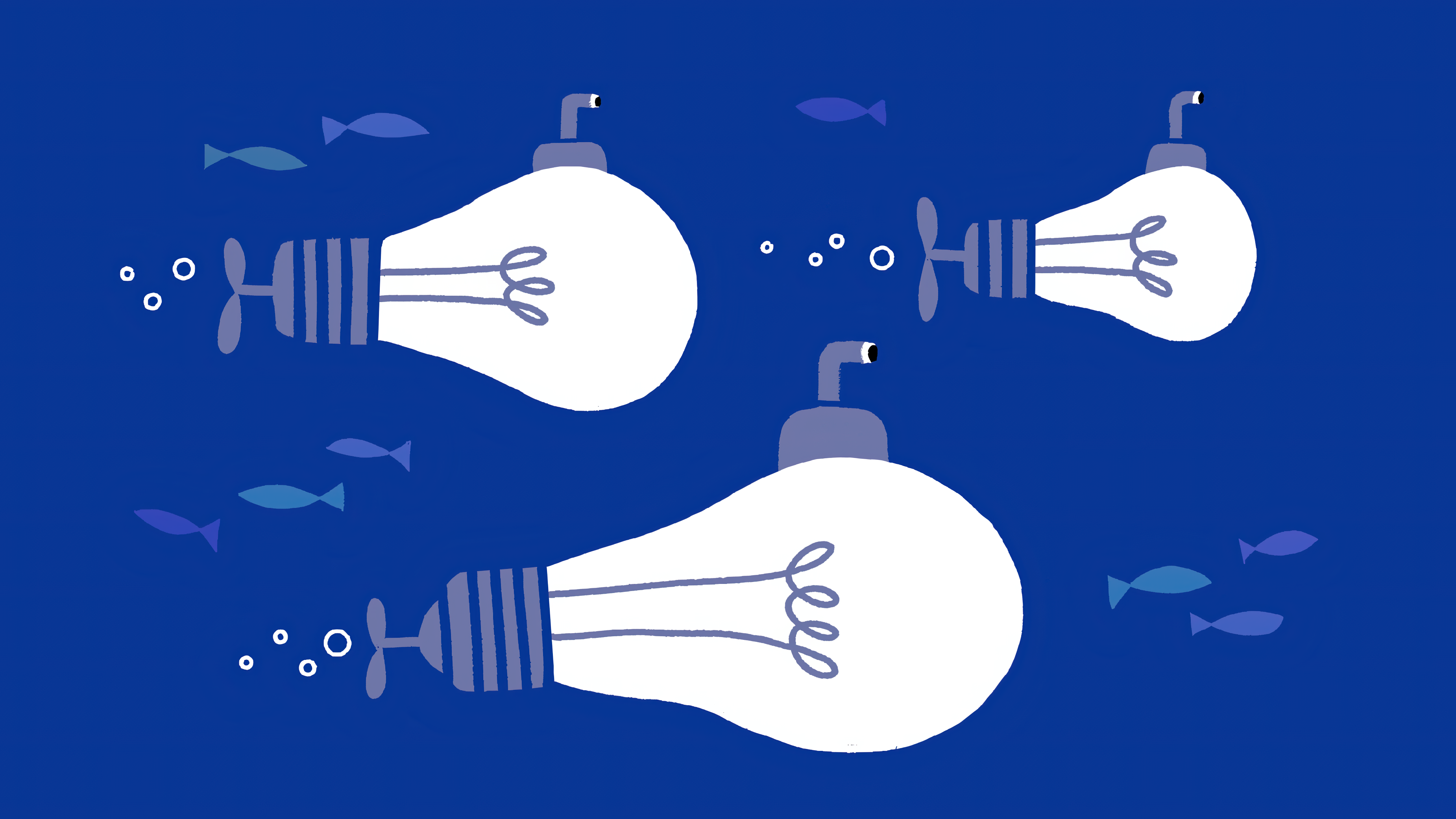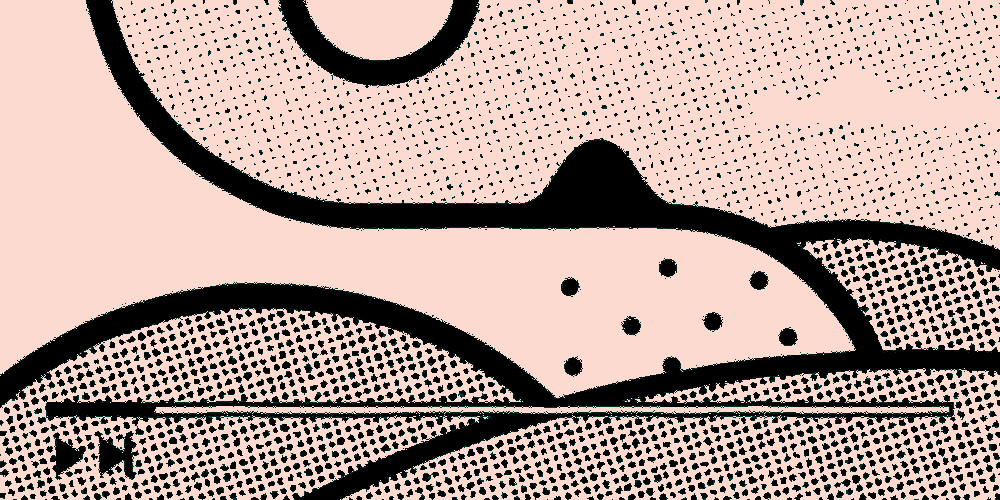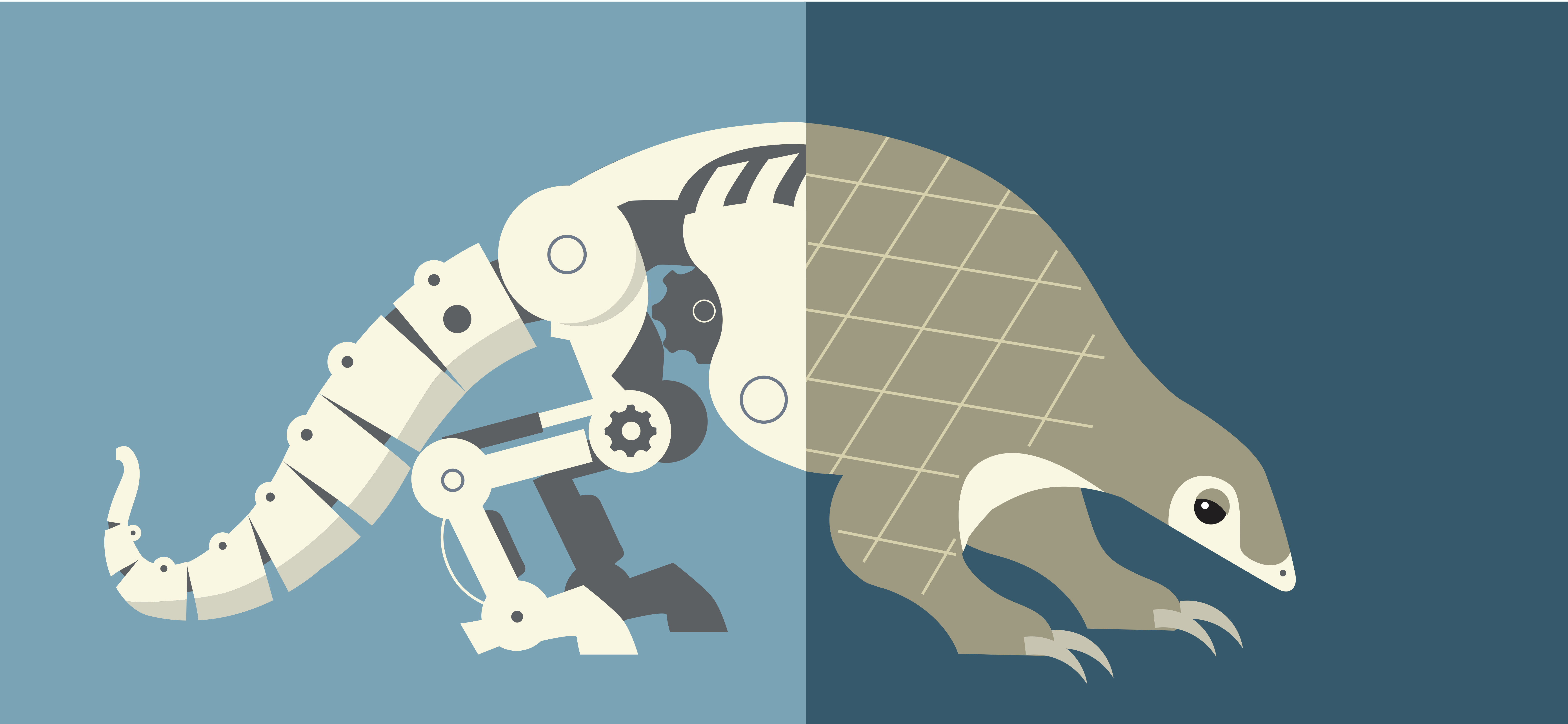Aus einer Innovationsperspektive sind nicht nur die Technologien, Dienstleistungen und Wissenssprünge interessant, die die Weltraumakteure bewusst anstreben. Historisch sind dagegen die Innovationen bemerkenswert, die sich unbeabsichtigt durch die Raumfahrt ergeben haben. Folgt man dieser Spur, lässt sich antizipieren, dass New Space über das naive Träumen hinausgeht. Das Wiederentdecken des Weltraums verspricht auch Arbeitsplätze und alltägliche Innovationen, die irgendwann der gesamten Gesellschaft zugutekommen.
Auf ihrer Webseite präsentiert die NASA eine Vielzahl solcher Innovationen. Die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft beansprucht etwa die Entwicklung des kabellosen Vakuumstaubsaugers, der Gefriertrocknung oder der drahtlosen Kopfhörer für sich. Zwei andere unbeabsichtigte Entwicklungsgeschichten sind besonders interessant.
Raumfahrt und die Solarenergie
Faszinierend sind erstens die Überschneidungen in der Geschichte von Raumfahrt und Solarenergie. Zwar gehen die Anfänge der industrialisierten Sonnenenergie auf das 19. Jahrhundert zurück, aber durch die Raumfahrt ergab sich ein Meilenstein mit grosser medialer und wissenschaftlicher Wirkung.
1958 wurde «Vanguard 1» (1.5 Kilo, Durchmesser von 16,5 cm) als vierter Satellit ins All katapultiert. Es war das erste Raumfahrzeug, das zur Stromversorgung auf die Photovoltaik setzte. Die Portraitaufnahmen von Vanguard zeigen, wie winzig die von den Bell Laboratorien entwickelten Siliziumzellen waren – erst recht im Vergleich zu den riesigen Solarparks der Gegenwart. Die Militärs hatten der Sache allerdings misstraut und statteten Vanguard zusätzlich mit einer Batterie aus. Ihre Skepsis war unbegründet. Die Signale des solarbetriebenen Senders konnten über sieben Jahren empfangen werden, die Batterien dagegen hielten gerade mal drei Monate. Gemäss NASA ist Vanguard 1 der älteste Satellit, der noch immer durch das All fliegt.
Um die Solarenergie irdisch und massentauglich zu machen, mussten die Kosten sinken und neue Anwendungsfälle getestet werden. Die Verbreitung führte über Solarzellen zur Beleuchtung von Bojen, die als Navigationshilfen dienten – eine Anwendung, bei der ebenfalls die öffentliche Hand involviert war.
Raumfahrt und der neue Blick auf die Erde
Eine zweite überraschende Innovation der Raumfahrt war der neue Blick auf die Erde. Aus der Ferne erkannten die Astronauten beim Blick auf die aufgehende Erde einerseits deren Zerbrechlichkeit. «We came all this way to explore the Moon, and the most important thing is that we discovered the Earth» – wird der Apollo-8-Astronaut Bill Anders regelmässig zitiert. Anderseits wurde durch den Blick aus dem All die Erde als Einheit sichtbar, auf der die Zukunft aller Bewohnenden zwangsläufig miteinander verbunden ist.
Die «Blue Marble», aufgenommen 1972 auf der Apollo-17-Mission, zählt zu den symbolträchtigsten Bildern des 20. Jahrhunderts. Rückblickend wird es eng mit dem Aufstieg der modernen Umweltschutzbewegungen seit den 1960er Jahren verknüpft. Genauso beeinflusste Blue Marble die antiautoritäre und antielitäre Gegenkultur des Silicon Valleys, wo eine bunten Truppe aus Systemtheoretiker:innen, Umweltschützer:innen, Computerfreaks und Anhänger:innen psychodelischer Drogen ein vernetztes, ganzheitliches Denken forderte.
Sie sahen eine Zukunft vor, in der Netzwerke es Individuen und Communities erlauben sollten, dezentral zu entscheiden. Der «Whole Earth Catalog» (samt Cover der blauen Murmel auf dem ersten Cover) illustriert diese Denkweise und wird heute als analoger Prototyp des Internets verstanden. Er war genauso Wissensverzeichnis wie Versandkatalog und ermunterte zur Do-it-Yourself-Kultur, ohne aber Distanz zum Kapitalismus zu nehmen. Man kann die Blue Marble Perspektive deshalb auch als Anfang einer Denkweise setzen, die mit Hilfe von Netzwerken den gesamten Globus umspannen, wenn nicht gar beherrschen will.
Was könnte es dieses Mal die unbeabsichtigte Innovation sein?
Die möglichen unbeabsichtigten Folgen der Weltraumwirtschaft im 21. Jahrhundert zu benennen, ist noch spekulativer als die antizipierten Innovationen. Ich möchte deshalb mit Fragen arbeiten – und konzentriere mich auf die positiven Ausblicke: