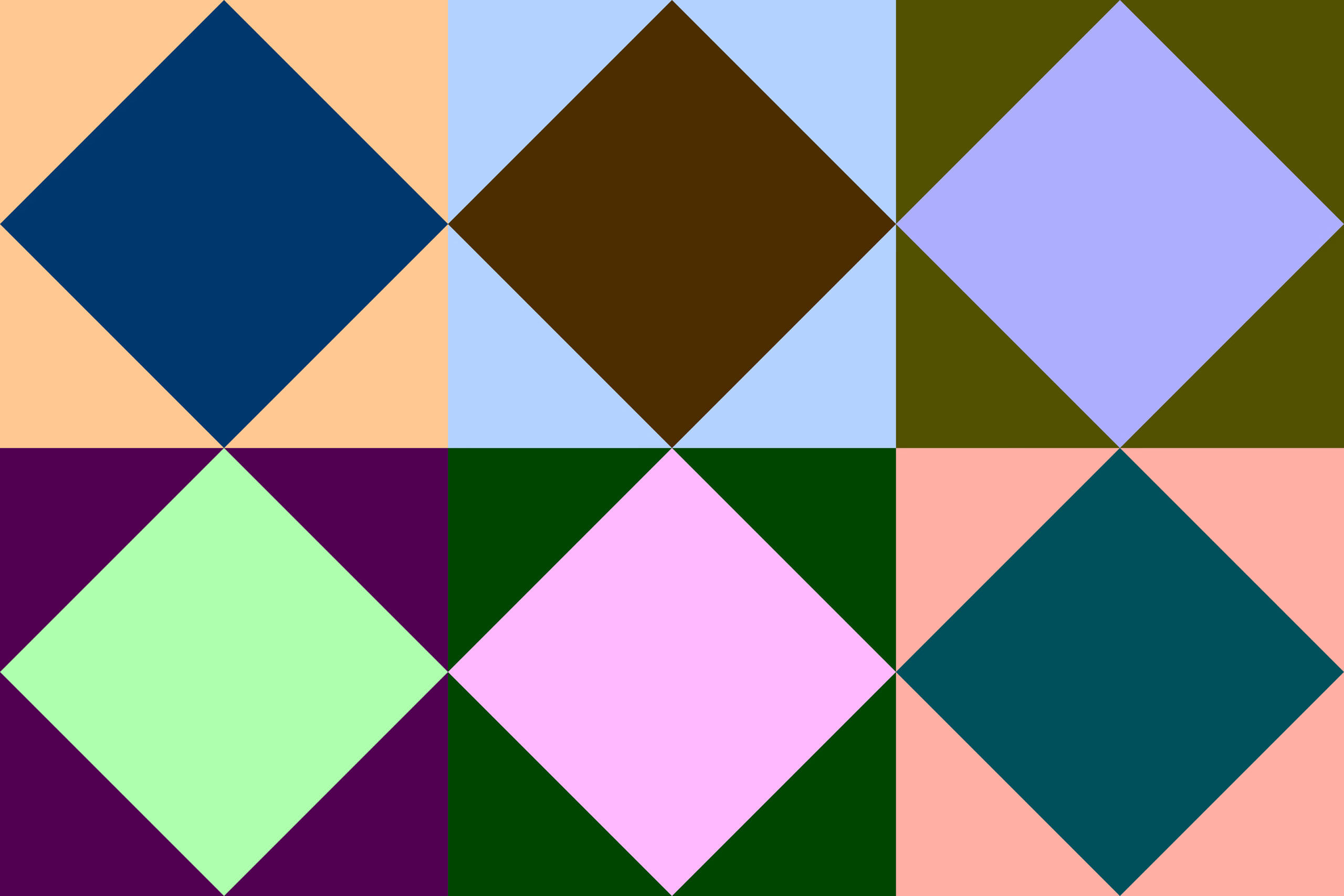Gegen die digitalen Ritter
Die Unternehmen, die sich in der Gegenwelt der Plattformen zusammenfinden, verzichten darauf, ihre Angebote zu digitalisieren. Kunden werden nicht zu Mitarbeitern gemacht, Vertrieb und Betreuung nicht online abgewickelt. Effizienz und Wachstum stehen nicht im Vordergrund. Stattdessen setzen sie auf den persönlichen Kontakt, das Glück des Moments, auf das Unikat, das Sinnliche und Emotionale. Offensichtlich eignen sich jene Güter besonders für die Gegenkultur, die sich nicht digitalisieren lassen. Sie umfassen zum einen all jene Produkte, die wir mit unseren Händen anfassen können, unsere Kleider, Nahrungsmittel und Möbel. Diese Kulissen unseres Alltags bleiben so lange relevant, wie wir nicht vollständig in die Virtualität umgezogen sind. Je mehr wir das Unikat schätzen, desto offensichtlicher der Verweis auf das Handwerk und kleine Strukturen, die anders als Nestle und IKEA, das einzigartige Nicht-Perfekte hervorbringen.
Das Nicht-Digitalisierbare
Zur Gegenkultur gehören auch Produkte und Dienstleistungen, bei denen wir das Menschliche bewusst wahrnehmen. Der Vorzug gegenüber den Maschinen kann objektiv darin bestehen, dass die Maschine zu ungeschickt oder zu teuer ist. Er kann auch durch persönliche Präferenzen entstehen – wenn wir uns in der Obhut von Menschen wohler, besser verstanden fühlen. Diese Vorzüge umfassen das Sinnliche und Emotionale – im Restaurant, im Krankenhaus, im Theater. Im Gegensatz zu den Maschinen zweifeln, trauern, altern, lieben wir, haben Sex. Wir essen, werden betrunken und krank, sterben. Weil den Maschinen diese Erfahrungen fehlen, sind sie nur bedingt fähig, uns in Situationen zu unterstützen, die direkt mit dieser Menschlichlichkeit zusammenhängen. Um sich gegen die digitalen Ritter zu wehren, sind die Anbieter menschlicher Produkte und Dienstleistungen allerdings auf eine genügend grosse Kundschaft mit entsprechender Zahlungsbereitschaft angewiesen.
Gegenkultur als analoge Revolution
Das Anti-Digitale beschreibt eine zweite Kategorie von Unternehmen, die sich der Logik der Skalierbarkeit entziehen wollen. Sie finden sich im Dunstkreis der Gegenkultur der Offliner, die sich nicht widerstandslos der Digitalisierung und ihren Treibern hingeben will. Untergruppen der Offliner sind jene, die in einer von Algorithmen geprägten Welt für das Zufällige kämpfen, sich gegen eine McDonaldisierung wehren, sich vor dem Transhumanismus fürchten, sich für ausgeprägten Datenschutz einsetzen oder sich vor Vereinsamung und Verdummung fürchten. Eine immer wichtigere Fraktion kämpft gegen die Gefahren des Energie- und Ressourcenverschleisses und eines ungehemmten Klimawandels. Die Schattenseiten und Nebenwirkungen der Digitalisierung zeigen, dass es unterschiedliche Varianten einer digitalen Zukunft gibt und sich in Alternativen neue Innovationspotenziale verstecken: Ein soziales Netzwerk, das an Datenschutz glaubt, ein kompostierbares Handy, ein Label für Produkte, die ohne Maschinen hergestellt wurden.
Wiederholte Probleme statt Skalierung
Eine dritte Gruppe von Unternehmen orientiert sich statt an den Versprechen des Plattformkapitalismus an den Herausforderungen einer Zukunft, in der das Digitale selbstverständlich geworden ist. Deren Errungenschaften werden einst ebenso selbstverständlich und unspektakulär sein, wie der Zugang zu Hochgeschwindigkeitszügen, Wasser oder Strom. Zu den wichtigsten Trends des Post-Digitalen gehören die Gesellschaft der Hundertjährigen, das Recycling, die Entdeckung der Sprachen von Tieren und Pflanzen oder überhaupt die biologische Transformation. Diesen Akteuren geht es weniger um Netzwerkeffekte als um gesellschaftspolitische Herausforderungen, die an vielen Orten des Planeten in ähnlicher Form auftauchen. Freilich besteht hier das Potenzial der klassischen Skalierung in Form von Economies of Scale. Durch Copypaste werden Fixkosten und Anlagevermögen reduziert. Allerdings besteht die Gefahr durch zu viel Einförmigkeit wie die Ritter zu entsinnlichen, zu entmenschlichen.
Und eben doch: Digitale Ritter im Nacken
Sich ganz den digitalen Rittern zu entziehen wird insbesondere schwierig, weil wir immer mehr online einkaufen und sich auch unser Informationsverhalten ins Internet verlagert hat. Wer heute einen Psychotherapeuten oder ein Restaurant sucht, durchblättert kein Telefonbuch mehr. Wir suchen im Netz – und dort häufig in den Verzeichnissen der Megaplattformen, via Google, Instagram und booking.com. Das setzt von wirtschaftlichen Akteuren digitale Präsenz, den Aufbau und die Pflege von sozialen Medien und damit die Kooperation mit Plattformen voraus. Diese Abhängigkeiten sind insofern problematisch, weil die Ritter Daten, Margen und die Besetzung der Kundenstelle erobern. Die Plattformen gewinnen durch Metadaten auch Wissen sowohl über die Gegenwart als auch über die Zukunft. So lange wir in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem leben, wird es zudem um Effizienz und die Senkung von Kosten gehen. Das erfordert im Sinne der Massenproduktion, wann immer möglich Abläufe zu standardisieren und (Logos, Kleidung, Rezepturen) zu wiederholen.
Die gesellschaftspolitische Dimension
Zwar können wir alle in unserem täglichen Konsum darauf achten, nicht nur Skalierbares und Effizienzgetriebenes zu kaufen. Doch die digitalen Plattformen sind vielerorts zu einer Art Infrastruktur des öffentlich-ökonomischen Lebens herangewachsen, die wir kaum noch umgehen können. Es scheint ganz so, als könnten wir der Dominanz der Ritter nicht einzig im Wirtschaftlichen entgegentreten. Offensichtlich hat deren Erscheinen eine gesellschaftspolitische Komponente. Die Ritter tangieren mehr als die Wirtschaft, sie prägen auch die Art und Weise wie wir als Gesellschaft funktionieren und wie sich Steuern, Bildung, Infrastruktur oder Sozialversicherungen verändern könnten. Im fünften Teil wird es folglich darum gehen, die Auswirkungen der Ritter auf dieser politischen Ebene zu diskutieren. Wir können uns entweder für Gesetze und neue Steuern einsetzen, soziale Innovation und sozialorientiertes Unternehmen fördern oder aber eine neue digital-ökonomische Aufklärung einfordern.